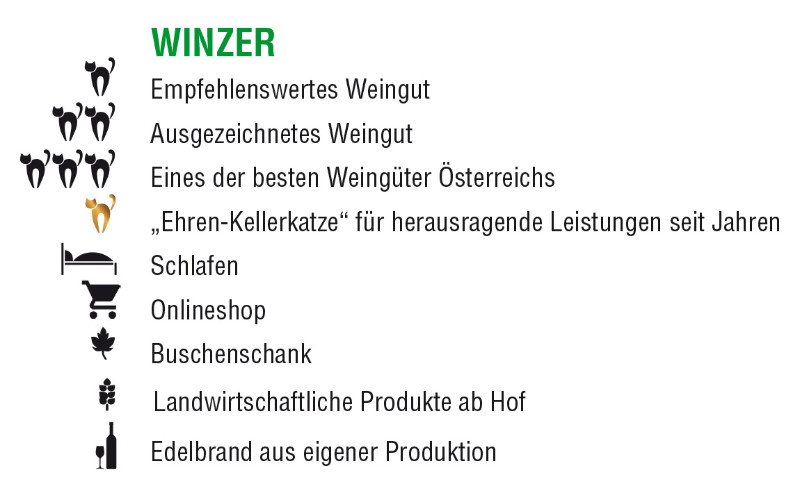Nach mehr als dreißig Jahren als Weinjournalist, Buchautor und Gastrokritiker hat Wirtshausführer-Herausgeber Klaus Egle für acht Wochen die Seiten gewechselt. Sich eine Kochschürze umgebunden und sich in die Küche des Fine Dining-Restaurants „Die Insel“ in Stade bei Hamburg gestellt um dort zu arbeiten. Als Vollzeit-Gardemanager von Mittwoch bis Sonntag mit Dienstplan und Zimmerstunden, Montag und Dienstag war frei. Wie es ihm dabei ergangen ist, erzählt er hier.
Fotos: Elisabeth Egle



Kann ich das? Schaffe ich das? Wozu überhaupt?
Echt jetzt…?
„Echt jetzt…?“ Das war die Frage, die mir in den Wochen bevor ich in Wien den ICE nach Hamburg bestieg, am häufigsten gestellt wurde. Wohlwollend und zustimmend meistens, auch wenn es vielleicht nicht die naheliegendste Idee ist, von der Bühne des Restaurants eben mal in den Maschinenraum der Küche zu wechseln. „Schuster bleib bei Deinem Leisten“ haben schon die Alten gesungen aber wenn sich immer alle an das gehalten hätten, befänden wir uns heute vermutlich noch in der Steinzeit. Natürlich: Etwas Neues auszuprobieren impliziert immer auch die Möglichkeit des Scheiterns inklusive dem schadenfrohen Kommentar des Publikums: „Wir haben es Dir ja gleich gesagt!“ Oder noch besser: „Wir wollten es ja nicht sagen, aber…“ Darum lieber: Man sollte. Man könnte. Man müsste. Eigentlich

Achtwöchiges Praktikum, fixer Dienstplan, fünf Tage Arbeit, zwei Tage frei.
Wozu
Angefangen hat es ja mit einer Frage meiner Frau Elisabeth, die stets nach neuen Wegen sucht und immer um die nächste oder, wenn möglich, auch gleich die übernächste Ecke schaut: „Wenn Du einfach machen könntest, was Du willst, was würdest Du dann am liebsten tun?“ „Kochen in einer Gastroküche“ war meine spontane Antwort und damit war die Idee auf der Welt. Eine Umsetzungs-Möglichkeit war schnell gefunden. Bei Tim Kappelmann, seit der Zeit, als er in Wien gelebt und gekocht hat, ein guter Freund von uns, der heute gemeinsam mit seiner Partnerin Rieke das Restaurant „Die Insel“ in Stade betreibt und dort auch als Küchenchef fungiert. Er bot mir spontan die Möglichkeit für ein mehrwöchiges Praktikum, mit allen Aufgaben, die jeder im Küchenteam wahrnimmt – und einem fixen Dienstplan: Fünf Tage Arbeit, zwei Tage frei. Davor gab es viele Fragen, die ich mir selbst stellte: Kann ich das? Schaffe ich das? Wozu überhaupt? Aber neugierig war ich auch. Und dann saß ich im Zug. Und stand am nächsten Tag in der Küche.



Der Körper gewöhnt sich an Vieles.
Von Null auf 100
Die erste große Herausforderung ist körperlicher Natur. Darauf war ich ja gefasst, irgendwie. Aber dass es so arg ist, habe ich nicht erwartet. Das stundenlange Stehen oder nur ganz kurze Wege gehen. Vom Posten – so heißt der Platz an dem du arbeitest – ins Kühlhaus und zurück. Oder zur Abwasch. Hin und her, so vierzig mal am Tag. Oder mehr, man zählt ja nicht. Am nächsten Morgen rebellieren die Füße, die wollen nicht aufstehen. Am übernächsten die Handgelenke… kommt vom Kürbisse in kleine Würfel schneiden. Und überhaupt das Lachstatar, das Chutney… alles will in schöne, kleine Würfel geschnitten werden und ich stelle mir so nach zwei, drei Stunden „schnibbeln“ die Frage, warum der liebe Gott die Fische, die Früchte und das Gemüse nicht einfach in kleinen Würfeln wachsen hat lassen. Und dann noch die Blase am Daumen vom Schnitzel klopfen – eine echte Niederlage, für jemanden, der so wie ich aus dem Schnitzelland Österreich kommt. Immerhin auch eine Erkenntnis: Schnitzel lieben sie einfach überall. Nach ein, zwei Wochen wird es besser, der Körper gewöhnt sich an Vieles.




Trägermedium, süße, saure, salzige Bestandteile, Gewürze, Aromaten. Macht für eine Vorspeise vielleicht dreißig, vierzig Bestandteile.
Mis en place contra Schwimmkurs
Als Gast stellt man sich das ungefähr so vor. Du bestellst und in der Küche fangen sie an zu kochen. Die Realität schaut ein bisschen anders aus. Was so schön mit „mis en place“ beschrieben wird, bedeutet in Wahrheit: 80 Prozent des Gerichts müssen fertig sein, der Rest griffbereit. Wenn das nicht so ist, gibt es in der Küche Schwimmkurs. Es geht um optimale Vorbereitung, Zusammenspiel und Timing. Da reden wir aber noch lange nicht von der Qualität der Produkte und der Zubereitung oder der dahinter stehenden Waren-Logistik, ohne die der Laden sowieso nicht läuft. Und schon gar nicht von der Kreation neuer Gerichte. Das ist keine Inspiration, die vom Himmel fällt, sondern echte Denkarbeit. Da geht es nicht nur um Originalität sondern auch um Umsetzbarkeit mit dem vorhandenen Team und in der gegebenen Zeit, Verfügbarkeit der Produkte und natürlich auch um Saisonalität, Regionalität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Ich weiß ja, dass ich nach acht Wochen wieder weg bin aber wie ist das, wenn man über Jahrzehnte als Koch arbeitet? Dann es ist ein Job und ein wirklich harter noch dazu. Die Arbeitszeiten, die körperliche Anstrengung, die vielen Routinetätigkeiten, vom Erdäpfel schälen bis zum täglichen Saubermachen des Arbeitsplatzes. Dafür gibt es wenig Anerkennung. Gelegentlich trägt der Service (der von den Gästen eigentlich nie gelobt wird!) ein Gästelob bis in die Küche: „Es war echt lecker!“ Also am Ende des Tages: Man muss es wirklich gern tun und ein bisschen Masochismus gehört wohl auch dazu, sonst sollte man sich nicht in eine Küche stellen.





In der Haushaltsküche gibt es Grenzen der Sinnhaftigkeit.
Es ist alles sehr kompliziert
Nehmen wir eine durchschnittliche Vorspeise, wie sie derzeit auf der Karte steht. Die besteht aus sieben, acht Komponenten, wobei wir hier keineswegs eine Pinzetten- und Pipetten-Küche kochen. Von denen bestehen einige wieder aus etlichen Komponenten – Trägermedium, süße, saure, salzige Bestandteile, Gewürze, Aromaten. Macht für ein Gericht vielleicht dreißig, vierzig Bestandteile. Dazu das Handling der einzelnen Zutaten, schneiden, beizen, einlegen, dämpfen, vakuumieren, abkühlen. Klingt kompliziert, ist es auch. Aber es passiert in einem laufenden Prozess, in dem alles ineinandergreift. Was ausgehen könnte, wird nachproduziert. Ich bin selbst ein begeisterter Hobbykoch, erkenne aber hier die Grenzen der Sinnhaftigkeit, wenn man in einem privaten Haushalt kocht… Wollen wir nicht lieber essen gehen!?


Kochen ist Wissen
Mein Partner am Gardemanger, das ist der Vorspeisen-Posten, ist Christian – ein echter Lichtblick. Kann alles, weiß alles, war Küchenchef im Michelin-Sterne-Restaurant in Hamburg, hat sein eigenes Restaurant in Stade geführt und, und, und. Er unterstützt seinen ehemaligen Lehrling und jetzigen Freund und Chef Tim auf der Insel, weil er das in Zeiten der grassierenden Personalnot wichtig und richtig findet: „Ich kann ihn doch hier nicht im Stich lassen!“ Für drei, vier Tage in der Woche kommt er und brennt mit seinen 71 Jahren immer noch lichterloh für die Gastronomie. Ein Motivator, der pfeifend und grüßend täglich ein bisschen früher in den Dienst kommt als ausgemacht (dafür geht er später) und der für jeden ein anerkennendes Wort hat. Christian zeigt mir, wie man beim Schneiden richtig steht, damit man nicht nach zehn Minuten Rückenschmerzen hat, wie man einen Zucchini sauber zuputzt, Tatar schneidet, Fleisch pariert, kübelweise Orangen filetiert. „Leg ein Küchentuch unters Schneidbrett, dann wackelt es nicht rum“. Oder: „Halt das Messer anders, dann geht’s leichter…“ Stimmt!


Wir haben es wieder einmal geschafft!
Kochen ist Teamwork und ein Knochenjob
Im Restaurant von Tim arbeiten ein Abwäscher, drei, vier Serviererinnen, vier Köch:innen. Kommt der erste Bon ausgedruckt, ist sofort Hochbetrieb. Jetzt weiß jede/r, was er oder sie zu tun hat. Exaktheit, Timing, Logistik, alles ist wichtig. Schon nach ein paar Minuten läutet zum ersten Mal die Glocke. Service!
Wenn ich gelegentlich an einem „heißen“ Posten, wie dem Entremetier, wo die Beilagen gemacht werden, arbeite, dann verstehe ich, warum Tim den Gardemanger-Posten schmunzelnd als „Erholungsheim“ bezeichnet. Hier wird es schnell einmal hektisch und heiß auch, weil das ist ja das Thema, dass alle Komponenten am Pass nahezu zeitgleich und heiß auf die – vorgewärmten – Teller kommen. Da schwitzt man als Koch ganz schön, dabei haben wir draußen um die Null Grad und die Fenster sind gekippt. Und wie ist das im Hochsommer? Man braucht pro Tag ungefähr so viel Flüssigkeit wie ein Rennradfahrer bei einer Tour-de-France-Etappe und nach ein paar Stunden ist die Kochjacke, die zuerst blau war, weiß – vom Salz. Aber dann kommt am Ende der Moment, wo man sich gegenseitig – virtuell oder tatsächlich – auf die Schulter klopft und sagt: „Wir haben es wieder einmal geschafft!“ Das ist ein gutes Gefühl. Ach ja, bevor es jetzt zu idyllisch wird, heißt es noch Arbeitsplatz sauber machen, Boden fegen, Müll raus tragen. Jetzt weiß ich wenigstens, warum der Feierabend so heißt – bin aber zu müde dazu.


300 Prozent geben
Ist man Wirtin oder Wirt, ist man heute ständig auf Personalsuche. Der Lehrling bricht ab, die Köchin wird schwanger, die Aushilfe ist krank. Es ist ein ständiges Jonglieren und Disponieren und geradezu eine Kunst, den optimalen Personalstand zu haben. Hat man zu wenig Leute, haben die Dauer-Stress und auch bald keine Lust mehr zu arbeiten. Hat man zu viele, rechnet sich das Ganze bei allem Aufwand, den man ja trotzdem treibt, nicht mehr. Als Wirt und Wirtin bist Du in diesem ganzen Spiel immer die Knetmasse und musst alles ausgleichen. Ein befreundeter Wirt in Stade hat es so formuliert: „Als Wirt musst Du immer 200 Prozent geben, damit Du verdienst!“ Und wenn jemand vom Personal ausfällt? Dann 300 Prozent.

Gibt es ein Fazit?
Habe ich kochen gelernt? Auch, aber da übe ich ja schon seit ein paar Jahrzehnten. Vor allem aber habe ich viel über das Kochen als Beruf gelernt und über’s Wirt sein auch. Ich bleibe dabei: Ohne die Liebe zur Sache geht es nicht, oder, wie so mancher Wirt sagt: „Zum Wirt musst Du geboren sein!“ Darüber hinaus aber braucht man jede Menge Fertigkeiten und Qualifikationen, von denen Kochen nur eine ist. Tatsächlich ist es ein schöner aber auch herausfordernder Beruf und ich habe wirklich größten Respekt vor jedem Menschen, die diese Herausforderung täglich annimmt und erfolgreich meistert.
Da denke ich, unter Berücksichtigung meiner „Vor-Ort-Recherche“ auch darüber nach, wie das mit dem Arbeiten als Koch generell gelingen kann. Die Voraussetzung ist wohl die Begeisterung für diesen außergewöhnlichen Beruf. Entweder, mit seinen Händen (und dem Kopf, der sie steuert!) auf wundersame Weise aus Grundzutaten etwas Neues, Schönes und Gutes zu schaffen, ähnlich wie ein Maler aus seinen Farben ein Bild malt. Oder eben jemanden zu umsorgen, zu beraten, ihm Gutes zu tun. Außerdem ein anständiges Gehalt und, für die Jungen fast noch wichtiger: Arbeitszeiten, die ihnen ein Leben außerhalb der Küche oder Gaststube ermöglichen. Eine faire Trinkgeldregelung natürlich auch – was reinkommt, wird geteilt. Ja, und arbeiten muss man halt schon auch wollen, immerhin ist die „work“ auch ein Bestandteil der vielzitierten „work-life-balance“.
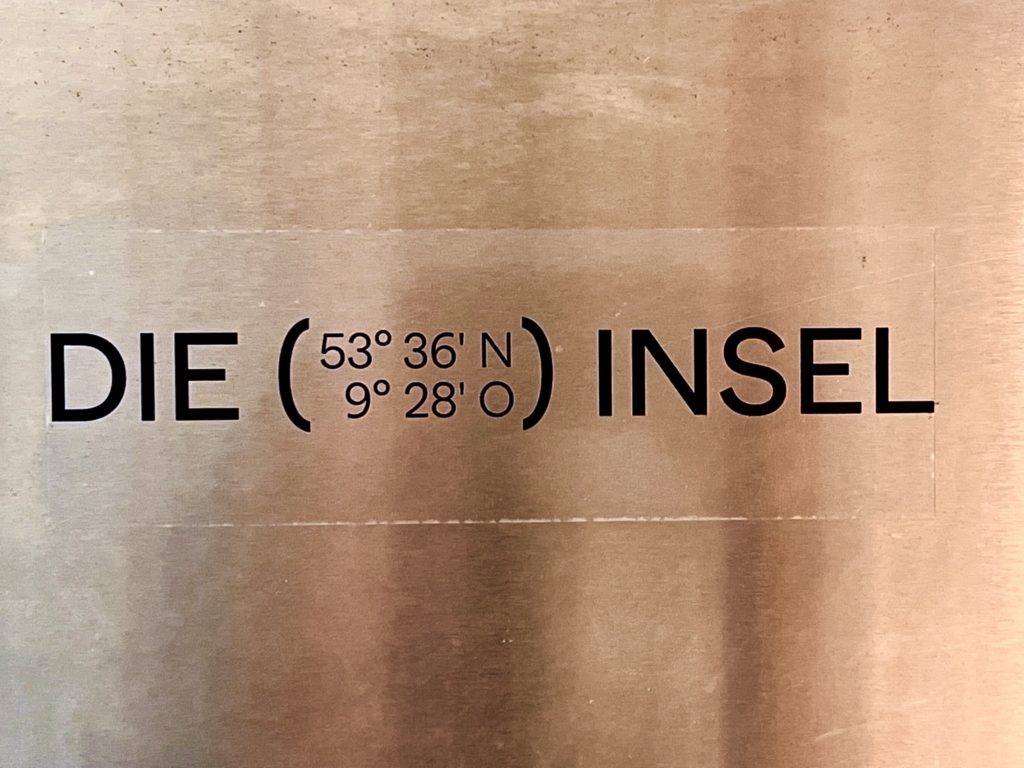
Die Insel
21680 Stade, Auf der Insel 1
Tel. 0049-4141-2031
www.insel.restaurant
Auf der Stader Museumsinsel hat Tim Kappelmann im Sommer 2021 inmitten einer historischen Kulisse seine moderne Vision von Gastfreundschaft eröffnet. Das Areal beherbergt eines der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands, vollständig umgeben vom Wasser im ehemaligen Burggraben. Das Restaurant ist ein traditioneller Anlaufpunkt der Stader bei Feierlichkeiten aller Art und besonders für Hochzeitspaare gibt es in Stade keine schönere Location. Mit Tim Kappelmann hat ein Pächter das Lokal übernommen, der die Stader kennt und viel Erfahrung mitbringt. Nach seiner Lehre im Restaurant Knechthausen war er rund drei Jahre in Wien, wo er unter anderem mit Größen wie dem Top-Küchenchef Joachim Gradwohl gearbeitet hat, ehe er gemeinsam mit einem Partner das Knechthausen übernahm und anschließend die Golfgastronomie Eysten in Deinste bespielte, ehe er auf die Insel kam.
Das mit einem traditionellen Reetdach gedeckte Lokal wurde gründlich aufgefrischt und auch in der Küche wird kreativ und zeitgemäß aufgekocht, ohne ganz auf Klassiker wie das Wiener Schnitzel oder die Geschmorte Rinderschaufel zu verzichten. „Ich koche mit frischen, hochwertigen und vorwiegend regionalen Zutaten am liebsten so, wie ich selber gerne esse“, verrät Tim Kappelmann und ergänzt: „Süß, sauer, salzig und knusprig sind Komponenten, die in jedem meiner Gerichte vorkommen!“
Ein Abstecher nach Stade lohnt sich übrigens auch, wenn man in Hamburg einen Städtetrip macht: Mit der S-Bahn ist man in einer Stunde in Stade und erreicht vom Bahnhof in fünf Minuten zu Fuß die Insel.